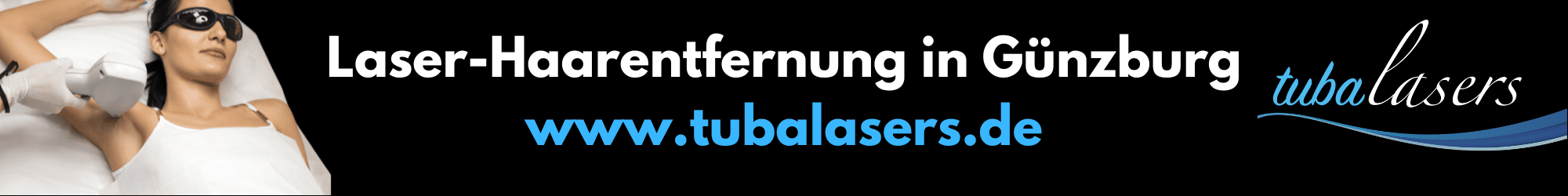Im Juli 1995 verlor Europa seine Unschuld. In den Hügeln um Srebrenica ereignete sich ein Verbrechen, das bis heute nachhallt: Mehr als 8.000 Menschen wurden im Völkermord von Srebrenica ermordet.
Dieser Film und die begleitende Reportage wollen nicht erklären, was damals geschah – darüber wurde viel gesprochen, von Stimmen, die es besser einordnen können. Stattdessen richtet sich der Blick auf die Gegenwart: auf die Menschen, die heute den Weg gehen.
Seit 2005 findet der Marš Mira, der Marš des Friedens, jährlich statt. 2025 nahmen mehr als 6.000 Menschen teil. Drei Tage, rund 100 Kilometer zu Fuß, durch Berge, Wälder, Hitze und Regen. Es ist derselbe Weg, den die Menschen 1995 gehen mussten – nur in umgekehrter Richtung. Damals war es ein Weg zur Rettung, heute endet er in Potočari, am Ort des Gedenkens.
Der Marš Mira ist mehr als ein Gedenkmarš. Er ist ein stiller Protest gegen das Vergessen, ein Zeichen der Solidarität und eine lebendige Erinnerung an die, die nicht mehr da sind. Jeder Schritt ist Erinnerung. Jede Pause ein stilles Gebet. Jeder Blick in die Landschaft trägt Geschichte.
Unter den Teilnehmenden waren auch drei Freunde aus Ulm: Damir, der bereits zum fünften Mal dabei ist, Samir, der seinen ersten Marš ging, und Neri, für den es das dritte Mal war. Unterschiedliche Wege führten sie hierher, doch ein gemeinsames Ziel vereinte sie – Erinnerungen lebendig zu halten.








Auf ihrer Reise trafen sie auf viele bewegende Persönlichkeiten: Admir und Hayruddin, die den Marš schon viele Male gegangen sind, oder Sejdalija Abdurahmanovic, der im Juli 1995 unter Lebensgefahr Menschen aus der Gefahrenzone rettete und seither den Marš anführt – ein Symbol für Tapferkeit und Menschlichkeit.
Die Strecke führt von Nezuk über Kamenica und Konjević Polje bis nach Potočari. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität gehen Seite an Seite, jung und alt, vereint durch das gemeinsame Ziel: zu erinnern, zu mahnen und Hoffnung zu geben.
Die Teilnehmer berichten von Strapazen: Regen, Kälte, matschige Wege, Nächte im Zelt. Und dennoch – niemand klagte, alle gingen weiter. Denn jeder Schritt war bedeutungsvoller als jede Erschöpfung. Begegnungen mit helfenden Menschen, Gastfreundschaft und spontane Gesten der Solidarität machten den Marš zu einem lebendigen Zeichen menschlicher Verbundenheit.
So auch die Geste eines Ehepaars, das trockene Kleidung brachte, nachdem es die durchnässten Teilnehmer im Fernsehen gesehen hatte. Als die Kleidung aufgebraucht war, gab Alija seine eigene Jacke an einen völlig durchnässten Marschierenden – eine kleine, aber unvergessliche Tat.
Der Marš Mira zeigt: Erinnerung lebt nicht allein durch Gedenkstätten oder Reden. Sie lebt durch Menschen, die den Weg gehen, ihre Geschichten teilen, ihre Solidarität zeigen. Er ist eine Antwort auf das Schweigen und Vergessen.
Marš Mira 2025 – ein Marš, der Schmerz in Hoffnung verwandelt, Erinnerung in Verantwortung und Trauer in Gemeinschaft.
(Katharina Zerr)