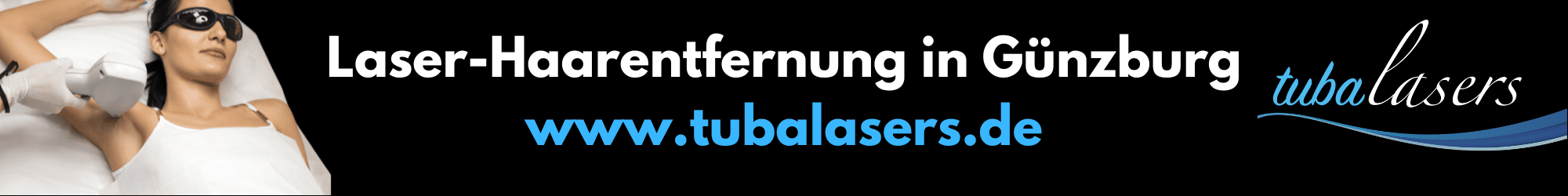Die finanziellen Investitionen in Bildung steigen in Deutschland, decken aber nicht ausreichend den Bedarf. Das geht aus dem nationalen Bildungsbericht 2024 hervor, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde.
In den vergangenen zehn Jahren sind die Ausgaben für Bildung demnach um 46 Prozent gestiegen. Bezogen auf die Wirtschaftskraft Deutschlands ist ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt allerdings nur um 0,2 Prozentpunkte angewachsen. Die Zahl der Bildungseinrichtungen lag 2022 um sechs Prozent über dem Stand von 2012. Auch die Anzahl der Bildungsteilnehmer hat sich 2022 im Vergleich zu 2012 erhöht – auf 17,9 Millionen Personen. Die Expansion von Bildungsangeboten hält bei teils steigender Nachfrage an. In einigen Bereichen, etwa bei der Ganztagsbetreuung, übersteigt die Nachfrage oftmals das Angebot.
Insgesamt stehe das Bildungssystem vor „großen Herausforderungen“, teilte das Bildungsforschungsinstitut DIPF mit. Dazu zählen demnach der Mangel an Fachpersonal, eine unzureichende Finanzierung, ein hoher Transformationsbedarf durch Zuwanderung und Digitalisierung, stagnierende und zum Teil sogar sinkende Schulleistungen sowie anhaltende soziale Ungleichheiten.
„Das System arbeitet vielerorts bereits am Anschlag, nicht zuletzt aufgrund stetiger Aus- und Umbaumaßnahmen und der angespannten Situation beim Fachpersonal“, sagte Kai Maaz, Geschäftsführender Direktor des DIPF. „Verschiedene weitreichende Entwicklungen bringen zusätzlichen Anpassungsdruck mit sich.“ So stelle etwa die Integration von Personen mit Flucht- und Migrationserfahrung inzwischen eine Daueraufgabe und große Herausforderung dar, für die es bislang keine nachhaltigen Konzepte gebe. „Bildungsprozesse müssen zudem vermehrt digital gestaltet und der Kulturwandel durch die Digitalisierung mitgedacht werden.“
Die Rekrutierung von Fachpersonal gestaltet sich laut Bildungsbericht in vielen Bildungsbereichen weiterhin sehr schwierig. So stieg etwa in Kindertageseinrichtungen die Zahl des pädagogischen Personals in den vergangenen zehn Jahren um 54 Prozent – in Westdeutschland wird dennoch eine bis 2035 anhaltende Personallücke erwartet. In Ostdeutschland kann der Personalbedarf inzwischen weitestgehend gedeckt werden, allerdings stellt sich der Personal-Kind-Schlüssel ungünstiger dar als in den westdeutschen Bundesländern.
Im schulischen Sektor waren 2023 unter allen neuangestellten Lehrkräften zwölf Prozent Seiteneinsteiger ohne klassische Lehramtsausbildung – mit deutlichen Unterschieden zwischen den Ländern. Für Lehrberufsqualifikationen, die im Ausland erworben worden sind, bestehen in den Bundesländern unterschiedliche Anforderungen für deren Anerkennung. Lediglich in 14 Prozent der Fälle werden die Qualifikationen als voll gleichwertig anerkannt. Bei zwei Dritteln aller Anträge wird die Anerkennung an die Erfüllung einer Ausgleichsmaßnahme, zum Beispiel Sprachkurse, gekoppelt.
In der beruflichen Bildung ist die Lehrkräftesituation ebenfalls sehr angespannt, zumal mehr als die Hälfte der Lehrenden bereits 50 Jahre und älter ist. Auch im Weiterbildungssektor fehlt dem Expertenbericht zufolge Lehrpersonal: 65 Prozent der Einrichtungen meldeten wachsende Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden.
Zugleich ist laut Bildungsbericht der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die die Mindeststandards im Lesen nicht erreichen, insgesamt und im internationalen Vergleich groß. Am Ende der Schulzeit verließen 2022 erneut mehr Jugendliche die allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluss. Das sind 6,9 Prozent gegenüber 5,7 Prozent im Jahr 2013.
Sozial bedingte Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung und dem Bildungserfolg bestehen weiterhin. Nur 32 Prozent der Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien erhalten eine Gymnasialempfehlung, verglichen mit 78 Prozent aus privilegierten Familien. Diese Disparitäten verringern sich den Forschern zufolge deutlich, wenn man die Schulleistungen und Schulnoten berücksichtigt. Dennoch zeigen sich erhebliche Unterschiede in der Umsetzung der Gymnasialempfehlung: Während nur sieben Prozent der Kinder aus privilegierten Familien trotz Empfehlung kein Gymnasium besuchen, sind es bei benachteiligten Familien 17 Prozent.
Der nationale Bildungsbericht wird alle zwei Jahre auf Basis von amtlichen Statistiken und sozialwissenschaftlichen Daten und Studien erstellt.
dts Nachrichtenagentur